top of page




Waldglashütten im Waldviertel
Erfahren Sie mehr über ...
-
die Geschichte der Waldglashütten im Waldviertel.
-
die Berufe, welche in den Glashütten ausgeübt worden sind.
-
die Entlohnung der Glasmacher.
-
die Lebensgewohnheiten der Glasmacher
 |  |  |
|---|---|---|
 |  |  |
 | 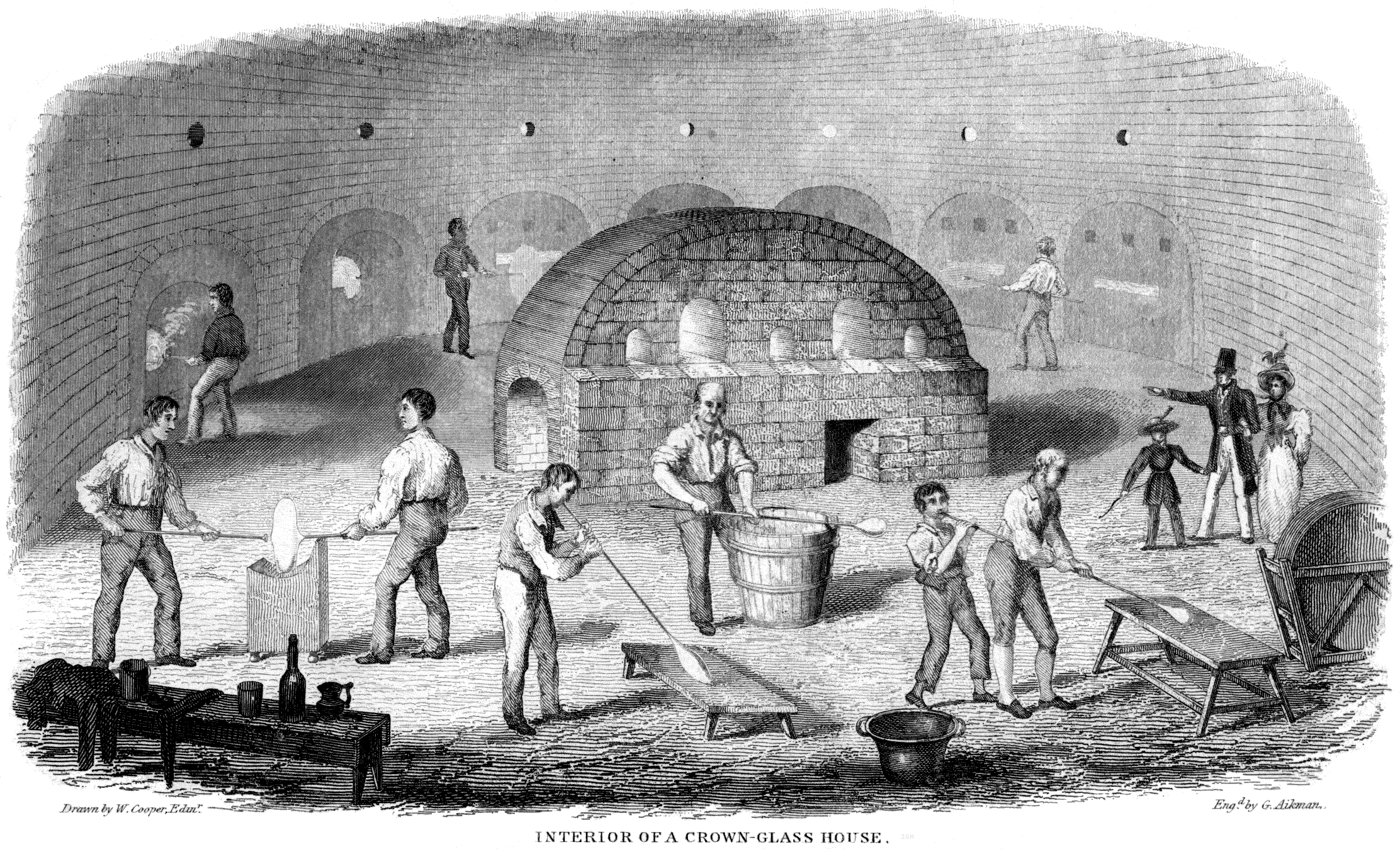 |
Waldglashütten im Waldviertel
Die ersten Glashütten im Waldviertel dürften im Weinberger Wald errichtet worden sein. In einem Urbar (Verzeichnis über Besitzrechte einer Grundherrschaft und zu erbringenden Leistungen ihrer Grunduntertanen) der Herrschaft Rappottenstein ist 1371 eine Glashütte in der Gegend von Traunstein bei Schönau genannt.
Insgesamt wurden zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert ca. 120 Glashütten gegründet und betrieben.
-
14. Jahrhundert - 2 Gründungen
-
15. Jahrhundert - 6 Gründungen
-
16. Jahrhundert - 20 Gründungen
-
17. Jahrhundert - 35 Gründungen
-
18. Jahrhundert - 37 Gründungen
-
19. Jahrhundert - 20 Gründungen
1

Der älteste Hinweis auf eine Glashütte in Böhmen, Nieder- und Oberösterreich bezieht sich auf einen Ort südlich der Donau. In Waidhofen an der Ybbs soll bereits im Jahr 1316 eine Glashütte mit dem Namen "glashut foedum" betrieben worden sein. Die ersten Glashütten im Waldviertel wurden im Weinsberger Wald errichtet.
Die erste Glashütte im Gebiet der Herrschaft Weitra war die im Urbar des Jahres 1499 genannte in Harmanschlag - am Südhang des Nebelsteins. Diese wurde jedoch im Jahre 1582 wieder geschlossen. Um 1630 errichtete die Herrschaft Weitra erneut eine Glashütte am alten Glashüttengelände in Harmanschlag.
Meilensteine der Waldviertler Glaserzeugung
-
1818
Josef Wenzel Ziech gelang es, erstmals im Waldviertel gänzlich farbloses Glas herzustellen.
-
1823
Nach langen Versuchen schaffte er es, dass von Georg Franz August von Buqoi erfundene schwarze Hyalitglas zu erzeugen. Ein Jahr später verstarb Josef Wenzel Ziech.
-
1825
Der Sohn von Josef Wenzel Ziech - Josef Ziech - übernahm 1925 die Glashütte seines Vaters und erzeugte Lithyalingläser, welche als Imitat für Edelsteine verwendet wurden.
-
1835
Die ersten Glashütten - Joachimsthal und Schwarzenau - kamen in den Pachtbesitz des Gratzener Förstersohnes Karl Stölzle, der den Absatz der Hütten noch weiter steigerte. 1850 wurde der Betrieb in beiden Hütten aufgrund eines Holzmangels und ungünstigen Transportwegen eingestellt. Karl Stölzle konzentrierte sich nunmehr auf die Glasherstellung in Nagelberg. Für die Gemeinden Harmanschlag und Hirschenwies bedeutete dies eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Glashütten verschwanden - die Glasschleiferei blieben in der Region rund um Hirschenwies.
Die erste Glashütte in Hirschenwies
Um 1660 gründete die Herrschaft jenseits des Nebelsteins die erste Glashütte im Ortsgebiet von Hirschenwies. Zum ersten Mal widmeten sich Glasschleifer und Glasschneider der Veredelung von Kristallglas. Auch heute wird noch am Standort Hirschenwies Glas in verschiedensten Formen veredelt und weiterverarbeitet.
Im Jahr 1711 erfolgte dann die Übersiedlung der Hirschenwieser Glashütte nach Schwarzenau. 1770 gründete Ergon Landgraf zu Fürstenberg im Grenzgebiet seiner Waldungen eine Glashütte und gab ihr den Namen "Joachimsthal". Einige Jahre später, im Jahr 1788, verpachtete er sie an den Glasmeister Josef Wenzel Ziech, der 1806 auch die Glashütte in Schwarzenau übernahm.
Glashütten im Waldviertel
Berufe der Glasmacher

Entlohnung
Lebensgewohnheiten
Aus dem Leben der Glasmeister und Arbeiter einer Glashütte
Der Glasmeister
Die Glasmeister der Frühzeit waren unternehmerisch, robuste Männer die Züge von Handwerkern, Künstlern und Rodungsleitern in einer Person vereinten. Bei kaufmännischen Geschick konnten sie es zu beachtlichem Wohlstand und Ansehen in der Gesellschaft bringen.
Der Hüttenschreiber
Er fungierte hauptsächlich als Buchhalter und Rechnungsführer in der Glashütte. Bei Hütten, die in herrschaftlicher Eigenregie betrieben wurden, war er als Vertrauensmann der Grundherrschaft sozusagen deren Geschäftsführer und somit Vorgesetzter des Glas- bzw. Hüttenmeisters. In allen anderen Hütten, die also im Privateigentum betrieben wurden, war der Hüttenschreiber dem Hüttenmeister untergeordnet.
Die Glasmachergesellen
Kurz Glasmacher genannt. Sie waren die eigentlichen Hauptpersonen jeder Glashütte. Zu ihrer Hauptaufgabe zählt vor allem die grundsätzliche Herstellung von Glas.
Der Schmelzer
Die Kunst des Schmelzers bestand in der Erzeugung der Glasmasse, des Grundstoffes der Glaserzeugung. Manche Schmelzer nahmen ihr gut gehütetes Geheimnis mit ins Grab. Als Zeichen seiner Würde und Bedeutung trug der Schmelzer eine weiße Schürze, die ihm dazu diente, die Farbe des Glases zu prüfen, wenn er eine Probe aus dem Hafen (Glasofen) "stach".
Folgende Materialen verwendeten die Schmelzer für die "Fritte" (Glasmasse):
-
Weiße Asche
-
Baumasche
-
Brennasche
-
Pottasche
-
Kies
-
Glasscherben
-
Salzstein
-
Salpeter
-
Arsenik
-
Braunstein
-
Kalk
-
Töpferton
-
Blaue "Schmollen"
Bei der Erzeugung von Rubinglas wurden zusätzlich Golddukaten in die Glasmasse hinzugefügt.
Der Schürer
In den Waldglashütten gab es zumindest zwei Schürer - einer für den Tagdienst und ein anderer für den Nachtdienst. Die Hauptaufgabe lag in der Sicherstellung des Feuers für den Glasofen. Auch in der Nacht musste der "Hafen" mit ausreichend Holz bestückt werden.
Die Glasmacherlehrlinge "Eintragbuben"
Sie hielten dem Glasmachergesellen den Model, trugen das fertige Glas in den Kühlofen und füllten bei Bedarf den Bierkrug nach. Ein Glasmacherlehrling war kein "grüner Junge" mehr. Schon im Alter von ca. 10 Jahren begannen die Söhne der Glasmacher "in die Hütte zu gehen", um ihren Vätern als "Eintragbuben" bei der Arbeit zu unterstützen. Wie bereits oben beschrieben, lag die Hauptaufgabe darin, das fertige Glas mit Hilfe von dünnen Stangen in den Kühlofen (Temperofen) zu transportieren.
Wenn es die Zeit zuließ, probierten sich die jungen Glasmacherlehrlinge bereits an der Pfeife bzw. übten mit den verschiedensten Glasmacherwerkzeugen ("Stielschere", Bodenschere, Hefteisen etc.). Einige Jahre später arbeiteten sie bereits Großteils als Gehilfen direkt am Glasofen.
Die Arbeitszeit der Glasmacher betrug - unterbrochen von kurzen Pausen - nicht selten bis zu 20 Stunden am Tag. 12 bis 14 Stunden täglich waren die Regel. Die Glasmacher konnten jederzeit - auch an Feiertagen und in der Nacht - sobald de "Fritte" die zum Blasen nötige Konsistenz hatte, zur Arbeit gerufen werden.
Die Lebenserwartung eines Glasmachers
war eher gering. Die extreme Hitze am Ofen (40°C – direkt am Ofen deutlich mehr), der häufige Temperaturwechsel, das gleißende Licht, der Blutandrang zum Kopf beim Glasblasen, das Hinunterstürzen des kalten Bieres und das verbreitete Arsenikschnupfen – zur Steigerung der Ausdauer, schädigten den ganzen Organismus des Glasmachers, insbesondere seine Lunge und seine Augen.
Anfang des 19 Jhdts. begannen in Böhmen die Glasmacher mit 40 Jahren bereits das Augenlicht zu verlieren und an asthmatischen Krankheiten zu leiden. Im ersten Jahrzehnt des 20 Jhdt. waren nur ca. 7 % der Glasmacher über das 50. Lebensjahr hinaus in ihrem Beruf tätig.
2
Entlohnung der Glasmacher
Die Glasmacher wurden nur zum Teil mit Bargeld entlohnt. Zum Teil erhielten sie vom Hüttenmeister jene Lebensmittel (Fleisch, Mehl bzw. Brot), die sie in ihren kleinen Landwirtschaften nicht selbst erzeugten. Auch erhielten sie, das zum Ertragen der Glasofenhitze notwenigen Bier. Manchmal erhielten sie einen Teil ihres Lohnes auch in Form des von ihnen selbst erzeugten Glases, das sie nach der Sonntagsmesse zu verkaufen oder gegen Hausleinen zu tauschen versuchten. In manchen Fällen wurden die Glasmacher auch an den Verkaufserlösen der Glashütte beteiligt.
Auszug aus einem Besoldungsbuch aus dem 17. Jahrhundert:
Die Glasmacher erhielten für die Produktion von 100 farblosen Fensterscheiben 16 Kreuzer und für 100 Waldscheiben 10 Kreuzer. Beim Hohlglas bekamen sie 50 Prozent des Verkaufspreises.
Für die Jahres 1719 bis 1749 gibt es bereits konkretere Mitschriften hinsichtlich der Vergütung.
Ein ausgelernter Glasmacher erhielt:
-
ein Drittel des Verkaufserlöses des von ihm erzeugten Kreideglases
-
ein Drittel des Verkaufserslöes des von ihm erzeugten "Painglases" (Beinglas)
-
die Hälfte des Verkaufserlöses des von ihm erzeugten grünen Glases
-
die Hälfte des Verkaufserlöses der von ihm erzeugten Schröpfköpfe
-
die Hälfte des Verkaufserlöses der von ihm erzeugten "Bläderl"
Ein Glasmacherlehrling im ersten Lehrjahr erhielt ein sechstel vom Verkaufserlös des von ihm erzeugten gewöhnlichen Glases und 11 Prozent vom Verkaufserlös des von ihm erzeugten gefärbten Glases. Im zweiten und dritten Lehrjahr wurde er mit einem Viertel des Verkaufserlöses des von ihm produzierten Glases entlohnt.
Die tatsächlichen Jahresverdienste sahen im Jahr 1717 folgendermaßen aus:
-
Kreideglasmacher - 215,2 Gulden
-
Glasmacher - 215, 1 Gulden
-
Lehrjunge im 2. Lehrjahr - 63,7 Gulden
-
Scheibenmacher - 109,9 Gulden
-
Schürer und Kiespocher - 68,1 Gulden
Die Löhne der Glasmacher waren - verglichen mit den Löhnen der Arbeiter anderer Branchen - relativ hoch.
3
Die Lebensgewohnheiten
Der Verkauf von Lebensmitteln und Bier an die Hüttenleut' war ein einträgliches Nebengeschäft für die Betreiber von Glashütten. Innerhalb eines Jahres lieferte das Brauhaus des Stiftes Schlägt zu einem Preis von 1,30 Gulden 208 Eimer Bier an die Glashütte in Schwarzenau. Diese wurden um 2,20 Gulden an die Hüttenleute weiterverkauft. Laut Aufzeichnungen wurde auch Branntwein mit einem Gewinnaufschlag weiterverkauft.
"Abraham a Sancta Clara zufolge, glaubten die Glasmacher, weil sie die Weingläser machen, dass ihnen das Saufen vor anderen gebühre."
Tatsächlich bewirkten die lange Arbeitszeiten und die Anstrengungen des Glasblasens in unmittelbarer Nähe des Glasofens einen übergroßen Durst, den die Glasmacher traditionellerweise mit Bier löschten. Der tägliche Bierkonsum der böhmischen Glasmacher lag bei rund 5-8 Litern Bier pro Tag. In Alt-Nagelberg lag der Bierkonsum im Jahre 1810 bei ca. 3-12 Litern täglich (rund ein Drittel des Lohns wurde für Bier ausgegeben).
Die weitere Verpflegung der Glasmacher war relativ einfach und bestand hauptsächlich aus Brot und Semmeln. Zu den Festtagen gab es aber auch manchmal festliche Kost. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1721:
-
Ostern
-
16 Pfund Rind, 15 Pfund Kalbfleisch und 5 Kannen Bier.
-
-
Pfingsten
-
4 Pfund Schweinefleisch, 7 Pfund Rindfleisch und 4 Kannen Bier.
-
-
Martini
-
10 Pfund Rind- und Schafsfleisch und 4 Kannen Bier.
-
-
Fronleichnam und Christi Himmelfahrt
-
je 5 Pfund Rindfleisch
-
Die jährliche Brotlieferung zu einer Glashütte betrug ungefähr 7.300 "Würff". 70 "Wüffe" Brot entsprachen ca. 1 Metzen Korn (62 Liter).
4

bottom of page

